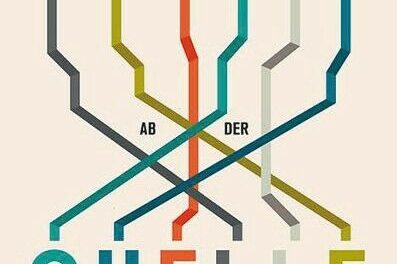Innovationsdynamik und Zeitwettbewerb üben einen starken Veränderungsdruck auf Betriebs- und Unternehmensstrukturen aus. Produktion und Vertrieb werden umorganisiert, Forschung und Entwicklung flexibel an die rasch wechselnden Kundenpräferenzen angepasst. Flexibilität, Schnelligkeit, Kostensenkung und Qualitätsverbesserung sind die Zielsetzungen, die hinter den modischen neuen Begriffen wie Just-in-time-Production, Lean Production und Lean Enterprise stehen.
Prof. Dr. Bernhard Nagel
Diese Veränderungen sind unter anderem mit einer Reorganisation der Zulieferbeziehungen verbunden. Zulieferteile werden bedarfsgerecht und kurzzyklisch angeliefert, Lagerhaltung wird ganz oder teilweise überflüssig. Unter dem Schlagwort Global Sourcing werden Ländergrenzen überschritten, wenn es darum geht, den günstigsten Anbieter als Zulieferer in die logistische Kette der Produktion zu integrieren. Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Automobilindustrie.
Diese logistische Verknüpfung von Herstellern und Zulieferern ist nur möglich, weil neue Informations- und Kommunikationstechnologien zwischen den Unternehmen eingesetzt werden können. Die datentechnische Vernetzung betrifft nicht nur die Produktion im engeren Sinne, sondern auch die Administration. Hinzu kommt, dass die Verknüpfung sich auch auf die der Produktion vorgelagerte Phase der Forschung und Entwicklung ausdehnt, ein Vorgang, der unter der Bezeichnung Simultaneous Engineering in den allgemeinen Wortschatz eingegangen ist.
Die Beziehungen zwischen Zulieferern, Herstellern und Absatzmittlern sind keine idealen Beziehungen zwischen Freien und Gleichen, es bestehen Abhängigkeiten, die dadurch gekennzeichnet sind, dass der Automobilhersteller das Netzwerk dominiert. Diese Dominanz zeigt sich nicht nur bei den Preisverhandlungen, sondern auch bei der Ausgestaltung der sonstigen Vertragsbedingungen, insbesondere auch bei der Regelung der Haftungsrisiken. Diese Haftungsrisiken können vorwiegend auf den Besonderheiten des Produktionsverbundes, also auf faktischen Ursachen beruhen. Sie können aber auch rechtlich induziert sein. Der Hersteller kann Pflichten auf den Zulieferer verlagert haben, die nach dem dispositiven Gesetzesrecht ihn selbst treffen würden. Häufig ist eine Kombination von beidem zu beobachten: So wird etwa die Qualitätssicherung vertraglich auf den Zulieferer verlagert und gleichzeitig ein technisch-organisatorisches Qualitätssicherungssystem vereinbart, das die faktische Grundlage zur Erfüllung dieser Verpflichtung schafft.
Neue Haftungsrisiken zwischen Herstellern und Zulieferern
In dem Maße, wie sich der Produktionsverbund zwischen Zulieferern und Herstellern intensiviert und internationalisiert, nehmen auch die Haftungsprobleme, vor allem bei Qualitätsmängeln, zu. Ausgangspunkt ist meist das Bestreben des Herstellers als der stärkeren Vertragspartei, sich soweit wie möglich von der Haftung freizuzeichnen. Diese Freizeichnungsmöglichkeiten stoßen auf rechtliche Grenzen. Ein Teil der Haftungsrisiken kann nicht durch vertragliche Freizeichnung aufgefangen werden. Hierzu zählen insbesondere die Produkthaftungsrisiken gegenüber einem geschädigten Dritten.
Sie sind gegenüber dem geschädigten Endverbraucher überhaupt nicht abdingbar, gegenüber anderen Geschädigten nur unter eingeschränkten Voraussetzungen (vgl. Nagel, DB 1995, S. 2581–2590). Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund einer allgemeinen Ausweitung der Haftungs- und Steuerungsnormen im privaten und öffentlichen Recht zu analysieren. Noch bis weit in die siebziger Jahre hinein gab es kein oder fast kein eigentliches Haftungs- und Steuerungsrecht im Bereich der Zusammenarbeit von Herstellern und Zulieferern, bei der Forschung und Entwicklung sowie bei der Produktion.
In den achtziger Jahren vollzog sich ein schleichender Wandel der Funktionen des Rechts, der zu völlig neuartigen Haftungsrisiken für produzierende Unternehmen, Zulieferer und Hersteller, und zu ebenso neuartigen Interventionsmöglichkeiten des Staates gegenüber diesen Unternehmen geführt hat. Einer der Markierungspunkte ist die EU-Produkthaftungsrichtlinie von 1985. Unter dem Einfluss dieser Richtlinie und zusätzlicher ausländischer Entwicklungen, die vor allem von den USA, dem Mutterland der verschuldensunabhängigen Produkthaftung ausgehen, sind Verschärfungen der Haftung zu erwarten.
Von dieser Entwicklung sind nicht nur das Unternehmen als juristische Person selbst, sondern auch die Leitungspersonen betroffen. Nicht nur die zivilrechtliche Haftung wird erweitert, auch im Strafrecht beginnt sich ein Grundsatz der Allzuständigkeit und Gesamtverantwortung der Unternehmensleitung durchzusetzen. Organisationsverschulden, etwa im Sinne allgemeiner Organisationsmängel, wird zunehmend als strafrechtlich relevantes Fehlverhalten behandelt. Kausalität setzt nicht mehr einen gesicherten fachwissenschaftlichen Nachweis voraus; hier und da stützt sich der Strafrichter bereits auf eine Mindermeinung, die sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit für Zusammenhänge mit der Schädigungseignung eines Produkts begnügt.
In jedem Fall kann sich ein Unternehmen nicht auf fehlendes Wissen über die Schädigungspotentiale eines neu entwickelten Produktes berufen. Es ist vielmehr verpflichtet, dieses fehlende Wissen selbst durch betriebliche Versuchsreihen zu erlangen. Bei diesen Versuchsreihen ist wiederum schon der strafrechtlich verantwortlich, welcher die Vorschläge anderer nicht energisch genug abgelehnt und den kollegialen Entscheidungsprozess nicht energisch genug in seinem Sinne zu beeinflussen versucht hat (vgl. Heine 1996, S. 361–391).
Die Verantwortung des Unternehmens wird auch durch eine staatliche Sicherheitsgesetzgebung im Verwaltungsrecht verstärkt, die mit einer Flut von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien immer weiter ausgebaut wird. Hierbei ist freilich zu beobachten, dass sich der Staat gleichwohl aus seiner Verantwortung für Risikoentscheidungen durch Rechtssetzung mehr und mehr zurückzieht. Dies zeigt sich etwa darin, dass die Legalisierungswirkung von öffentlich-rechtlichen Vorschriften und behördlichen Einzelfallentscheidungen, z.B. Genehmigungen, Punkt für Punkt abgeschwächt wird.
Unternehmerische Vertrauenspositionen, frei von Verantwortung zu handeln, wenn man sich im Einklang mit behördlichen Vorgaben befindet, werden zunehmend abgeschwächt. Man kann sich auf Genehmigungen immer weniger verlassen. Hiervon werden innovative Unternehmen stärker als andere belastet, da sie auf neue Gebiete vorstoßen, in denen sich eine juristische herrschende Meinung, gefestigte Rechtsprechung und Verwaltungspraxis noch nicht gebildet hat. Das Problem lässt sich vergröbert wie folgt kurz zusammenfassen: Die Verantwortung für Risiken, welche vom Gesetzgeber oder von staatlichen Behörden nicht hinreichend erkennbar auf das Unternehmen übertragen werden, belastet insbesondere das innovative Unternehmen, auch Zulieferer und Hersteller, die im Verbund forschen, entwickeln und produzieren.
Vertragshaftung, deliktische Haftung und Gefährdungshaftung
Betrachtet man die zwischen Herstellern und Zulieferern abgeschlossenen Verträge, so muss man sich von der Illusion frei machen, dass der Hersteller sich von den Haftungsrisiken freizeichnen könnte, die aus einer mangelhaften Qualität des Endproduktes resultieren. Dies gilt in jedem Fall für die Produkthaftungsrisiken, die deliktischer Natur sind und gegenüber dem Endverbraucher nicht abbedungen werden können. Wir beobachten zunehmend eine Dominanz der deliktischen Haftung (einschließlich der Gefährdungshaftung) gegenüber der vertraglichen Haftung. Deshalb soll auch die Produkthaftung im Mittelpunkt der folgenden Darstellung stehen.
Seit der Umsetzung der Produkthaftungsrichtlinie durch das Produkthaftungsgesetz von 1990 hat sich bekanntlich in Deutschland eine Zweiteilung entwickelt. Einerseits gilt nach wie vor die durch die Rechtsprechung entwickelte Produkthaftung, die im Rahmen von § 823 Absatz 1 BGB mit einer Beweislastumkehr in der Frage des Verschuldens arbeitet. Andererseits ist im Produkthaftungsgesetz (PHG), das am 1.1.1990 in Kraft trat, eine Gefährdungshaftung für fehlerhafte Produkte verankert. Für Ansprüche nach § 823 Absatz 1 gilt beispielsweise die Obergrenze von 160 Millionen DM bei Personenschäden nicht, die in § 10 Absatz 1 PHG festgehalten ist. Ferner gilt nicht die Beschränkung der Haftung auf privat genutzte Produkte ( vgl. § 1 Absatz 1 PHG).
Schließlich kann nach § 847 BGB Schmerzensgeld verlangt werden, was nach dem Produkthaftungsgesetz nicht möglich ist. Auch der Umstand, dass nach § 1 Absatz 2 Nr. 5 PHG der Ersatzanspruch ausgeschlossen ist, wenn ein Fehler nach dem Stand der Wissenschaft und Technik nicht erkannt werden konnte, als das Produkt vom Hersteller in den Verkehr gebracht wurde (sogenannter unvermeidlicher Entwicklungsfehler), kann im Rahmen der Haftung nach § 823 Absatz 1 BGB konterkariert werden: Die Verkehrspflichten im Rahmen von § 823 Absatz 1 wurden vom BGH auf sogenannte Produktbeobachtungspflichten ausgeweitet. Der Hersteller muss die Entwicklung des Produkts – auch im Zusammenhang mit Zubehörteilen – beobachten, auch nachdem er sie in den Verkehr gebracht hat. Entsteht ein Schaden, so muss er im Rahmen der Verschuldensprüfung nach § 823 Absatz 1 BGB nachweisen, dass er seine Produktbeobachtungspflicht erfüllt hat. Der Bereich der Fehler, die noch als unvermeidliche Entwicklungsfehler angesehen werden können, wird hierdurch sehr stark eingeschränkt.
Das Produkthaftungsgesetz geht in einigen Bereichen weiter als das durch die Rechtsprechung ausgeformte allgemeine Schadensersatzrecht aus § 823 Absatz 1. Dies gilt zum einen für die verschuldensunabhängige Haftung in § 1 PHG selbst, die noch über den nach der Beweislastumkehr im Rahmen von § 823 Absatz 1 erreichten Stand der Rechtsprechung zum BGB hinausgeht. Sie erfasst z.B. auch die Haftung für sogenannte Ausreißer, d.h. Produkte, deren Fehlerhaftigkeit trotz der zumutbaren Vorkehrungen nicht erkannt wurde. Zum andern fasst § 4 PHG den Begriff des Herstellers sehr weit: § 4 Absatz 2 PHG erfasst auch den Importeur. Wenn der Hersteller nicht festgestellt werden kann, gilt sogar der Lieferant als Hersteller (vgl. § 4 Absatz 3 PHG). Derartiges gibt es im Rahmen von § 823 Absatz 1 BGB nicht.
Der Verbraucher kann sich aussuchen, ob er im Falle eines fehlerhaften Zulieferteils den Endhersteller oder den Zulieferer auf Schadensersatz aus dem Gesichtspunkt der Produkthaftung nach § 823 Absatz 1 BGB bzw. § 1 PHG verklagt. Beide haften im Außenverhältnis als Gesamtschuldner. Vertragliche Haftungsausschlussklauseln können insofern nur noch Regressansprüche zwischen Hersteller und Zulieferer im Innenverhältnis berühren. Insofern dominiert die Produkthaftung heute schon die Vertragsgestaltung.
Grundsätze der Vertrags- und Haftungsbeziehungen
Die Rechtsprechung unterscheidet heute, was die Zulässigkeit der Vertragsgestaltung und der Haftungsregelungen angeht, zwischen vertikaler und horizontaler Arbeitsteilung. Vertikale Arbeitsteilung bedeutet, dass Konstruktion oder Fabrikation der gelieferten Ware beim Zulieferer liegen. Eine horizontale Arbeitsteilung kann zwischen mehreren Zulieferern bestehen, die z.B. gemeinsam ein sogenanntes Modul für das Endprodukt erstellen.
Für die vertikale Arbeitsteilung gilt: Hersteller und Zulieferer müssen den Vertrag so ausrichten, dass das Produkt sicher ist. Im Außenverhältnis haftet zwar jeder, soweit der Schaden auf das Gesamtprodukt (Hersteller) oder auf ein Zulieferteil (Zulieferer) zurückzuführen ist. Der Hersteller kann im Innenverhältnis jedoch Regress nehmen, wenn er seine vertraglichen Pflichten und seine Verkehrssicherungspflichten bei der Eingangskontrolle des Zulieferteils erfüllt hat, und zwar für den Schaden, für den er als Hersteller des Gesamtprodukts im Außenverhältnis haftet, jedoch auf dieses Zulieferteil zurückzuführen ist.
Maßgeblich für die vom Endhersteller zu erfüllenden Verkehrssicherungspflichten ist die jeweilige Sicherheitserwartung des künftigen Produktbenutzers. Diese Sicherheitserwartung richtet sich nach dem jeweils verfügbaren Stand von Wissenschaft und Technik (vgl. BVerfG NJW 1979, 359, 362). Problematisch ist, inwieweit der Zulieferer im Außenverhältnis gegenüber dem Endverbraucher haften soll.
In einer Entscheidung aus dem Jahre 1996 hielt der BGH (BGH NJW 1996, 2224) den Hersteller eines Schmierfetts für verantwortlich, weil die Lager eines Grim’schen Leitrades auf einem Schiff mit dem Fett geschmiert wurden, das Lager wegen der Untauglichkeit des Fettes festlief, zerstört wurde und das Grim’sche Leitrad während einer Seefahrt verlorenging. Entgegen den Prospektangaben des Herstellers entfaltete das Fett bei Temperaturen unter 35° Celsius, wie sie auf Seefahrten vorkommen, nicht die erforderliche Schmierwirkung. Der geschädigte Schiffseigner hatte nicht seinen Lieferanten, den Hersteller des Leitrades, sondern dessen Zulieferer, den Hersteller des Schmierfettes, in Anspruch genommen.
Nach der Rechtsprechung des BGH zu den sogenannten weiterfressenden Mängeln (vgl. schon BGH 67, 359 – Schwimmerschalter – dazu kritisch Nagel/Eger 1997 S. 123 ff.) haftet der Zulieferer in diesem Fall auch für den Schaden am Endprodukt. Für ihn ist das Endprodukt (Leitrad), in das sein Zulieferprodukt (Fett) eingefügt wird, eine andere Sache. Sein Produkt hat an dieser anderen Sache einen Schaden verursacht, den er ersetzen muss.
Es ist damit zu rechnen, dass der BGH seine Rechtsprechung fortsetzen wird, die unter der Bezeichnung Haftung für weiterfressende Mängel breit diskutiert und überwiegend abgelehnt wird (vgl. die Kritik und die Nachweise bei Reinicke/Tiedtke, 1997, S. 309–317; vgl. andererseits zustimmend Münchener Kommentar – Mertens 1997 § 823 Rz. 278). Demnach gilt: Den Zulieferer treffen Verkehrssicherungspflichten auch in Bezug auf das Endprodukt. Weiß er, wozu sein Vorprodukt bei der Herstellung oder Ausstattung des Endprodukts verwendet werden soll, so muss er den Hersteller des Endprodukts über die möglichen Gefahren aufklären, die durch sein Zulieferprodukt verursacht werden können. Entsteht ein Schaden, so muss auch er dem Endverbraucher wegen der Schäden am Endprodukt Ersatz leisten, in jedem Fall ist aber der Hersteller des Endprodukts dem Endverbraucher ersatzpflichtig, weil es fehlerhaft war.
In einer zweiten Entscheidung aus dem Jahre 1996 sprach der BGH dem Hersteller von Einbaumöbeln einen Schadensersatzanspruch gegen den Lieferanten des Lacks zu, der zur Ausstattung zweier Besprechungszimmer und eines Chefbüros verwendet worden war (BGH NJW 1996, 2507). Der Lackhersteller sei dafür verantwortlich, dass das Holz vergilbe, die Oberfläche verspröde und der Lack abplatze. Der Hersteller der Einbaumöbel hatte den Lack nicht direkt vom Hersteller gekauft. Der BGH sprach ihm den Schadensersatzanspruch nach §823 Absatz 1 zu, weil die Lackfehler zu Folgeschäden und zu einer Eigentumsverletzung des Herstellers der Einbaumöbel geführt hatten.
Auch Beeinträchtigungen fremder Sachen, die nicht deren Substanz treffen, z.B. Verschmutzungen, (BGH NJW 1981, 2250–Asbestzement-Platten) Verunreinigungen, (BGH NJW 1994, 517–Gewindeschneidemittel I; BGH NJW-RR 1995, 342–Gewindeschneidemittel II) Nässeschäden am Holzwerk infolge eines unzulänglichen Lackes (BGH NJW-RR 1992, 283) und Veränderungen in der Lackierung von Möbeln durch Bildung von Grauschleiern (OLG München, abgedruckt in Kullmann/Pfister, Produzentenhaftung, Kennzahl 75o5/18) sind bereits als Eigentumsverletzung anerkannt.
In diesem Fall wäre eine vertragliche Haftung aus dem Gesichtspunkt der Drittschadensliquidation möglich gewesen. Der Schaden ist beim Endverbraucher entstanden, er hat aber keinen vertraglichen Anspruch gegen den Hersteller. Der Werkunternehmer hat zwar einen vertraglichen Anspruch, ihm ist aber kein Schaden entstanden. Also muss es möglich sein, dass der Werkunternehmer den Drittschaden des Endverbrauchers beim Lackhersteller liquidiert. Zwischen beiden Ersatzansprüchen, dem aus Produkthaftung und dem aus Vertrag (Drittschadensliquidation), besteht Anspruchskonkurrenz.
Allgemein gilt: Auch den Hersteller treffen im Rahmen eines Produktionsverbundes zusätzliche Pflichten; delegiert er Pflichten an den Zulieferer, so hat er bestimmte Grenzen zu beachten. So darf er nur solche Zulieferer einschalten, welche die von ihnen hergestellten Produkte nach dem Stand von Wissenschaft und Technik mit der erforderlichen Sicherheit ausstatten können. Der Hersteller muss also die Qualifikation des Zulieferers für das jeweilige Produkt prüfen. Ferner muss er dafür Sorge tragen, dass die Spezifikationen, die er für das Zulieferprodukt gegeben hat, erfüllt werden. Hierzu muss er Kontrollen vornehmen.
Im Rahmen einer Qualitätssicherungsvereinbarung in der Just-in-time-Produktion werden derartige Kontrollen allerdings auf den Zulieferer verlagert (vgl. Merz 1992, S. 269 ff.; Bauer/v. Westphalen 1996, S. 26 ff., vgl. unten). Der Hersteller muss ferner dafür sorgen, dass der Zulieferer eine ausreichende Deckung durch eine Produkthaftpflichtversicherung sicherstellt, damit er im Schadensfall Ersatz leisten kann (Vgl. Fuchs, JZ 1994, S. 533 ff.).
Die Möglichkeit, Rechte und Pflichten zu verteilen, ändert sich bei horizontaler Arbeitsteilung. Sie ist vielfach zu beobachten, wenn mehrere Zulieferer gemeinsam ein sogenanntes Modul für das Endprodukt erstellen sollen. Hier kommt es zu einer Aufgabenteilung zwischen Hersteller und Zulieferer. Es werden Arbeitsgänge auf einen oder mehrere Zulieferer verlagert, d.h. die Verantwortung für die Zulieferleistungen soll auf einen oder mehrere Zulieferer konzentriert werden. Hat der Zulieferer hierbei eine Konstruktionsverantwortung übernommen, so ist er als Hersteller zu betrachten.
Dies bedeutet aber nicht, dass der Hersteller von seiner Konstruktionsverantwortung für das Gesamtprodukt befreit wird. Überträgt der Hersteller dem Zulieferer die Fabrikationsverantwortung für ein Modul, so muss er Stichproben durchführen. Es kommt aber hinzu, dass der Zulieferer, welcher die Verantwortung für das Modul übernommen hat, seinerseits für diesen Teilbereich als Hersteller betrachtet wird und auch für die Verkehrssicherheit der Vorprodukte des Moduls haftet.
Vertragliches Innenverhältnis Hersteller-Zulieferer
Im Innenverhältnis zwischen Zulieferer und Hersteller kann vertraglich vereinbart werden, wer für welche Produktsicherheit verantwortlich ist, wobei der Hersteller meist Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet. Nach §§1 Absatz 2, 24 AGBG werden zwar bei Kaufleuten Individualvereinbarungen von der Geltung des AGB-Gesetzes ausgenommen. Eine Individualvereinbarung setzt aber grundsätzlich voraus, dass neben der Abänderungsbereitschaft des Verwenders der AGB auch tatsächlich eine Abänderung der jeweils vorformulierten Klausel erreicht wird. Nur so erhält der Zulieferer eine reale Möglichkeit, seine genuinen Interessen durchzusetzen. Dies ist in der Praxis selten der Fall.
Umstritten ist, ob und unter welchen Voraussetzungen die Qualitätssicherungsvereinbarung eine volle Verantwortung des Zulieferers gegenüber dem Hersteller für die Sicherheit seines Produkts vorsehen kann (vgl. dazu u. a. schon verneinend von Westphalen 1993, S. 65–73 und bejahend Nagel, DB 1991, S. 319–327). Der Streit dürfte in absehbarer Zeit nicht vor den Obergerichten ausgetragen werden, weil kaum ein Zulieferer wagt, gegen einen Hersteller vorzugehen. Nach richtiger Auffassung ist die Verlagerung der Verantwortung für die Sicherheit seines Produkts auf den Zulieferer insoweit zulässig, als durch die Vereinbarung ein funktionsfähiges Qualitätssicherungssystem mit einer für beide Seiten zumutbaren Verteilung der Risiken geschaffen wird.
In jedem Fall ist es wichtig, bei den Verhandlungen die umstrittene Frage präsent zu haben, ob die Untersuchungs- und Rügeobliegenheit nach §§377, 378 HGB abbedungen werden kann. Nur dann kann der Hersteller in der QS-Vereinbarung die Verantwortlichkeit des Zulieferers für das Vorprodukt ausschließlich festlegen. Es ist festzuhalten, dass angesichts der ungeklärten Rechtslage sich die Haftungsrisiken des Zulieferers erheblich erhöhen, wenn der Hersteller laut Vertrag keine Wareneingangskontrolle mehr vornehmen muss. Die Haftungsrisiken sind summenmäßig besonders hoch, wenn das Endprodukt in die USA exportiert wird und dort Produkthaftungsklagen erhoben werden, bei denen die mangelnde Sicherheit eines Zulieferteils gerügt wird.
Vertragliche Innenregressklauseln für den Fall der Produkthaftung
Vertragsklauseln, welche das Innenverhältnis zwischen Zulieferer und Hersteller im Falle einer Produkthaftung betreffen (Innenregressklauseln), müssen vor allem beachten, wie sich die Darlegungs- und Beweislast im Verhältnis zwischen Hersteller und geschädigtem Dritten sowie zwischen Hersteller und Zulieferer regelt. Der Hersteller ist für die Sicherheit des Gesamtprodukts gegenüber dem geschädigten Dritten verantwortlich. Hat er Verkehrssicherungspflichten auf den Zulieferer vorverlagert, so muss er im Regressfall beweisen, in welchem Umfang eine derartige Delegation wirksam geworden ist.
Was den Schaden angeht, muss der Hersteller nachweisen, dass dieser durch einen Mangel des zugelieferten Einzelteils verursacht wurde. Der Zulieferer haftet für den Schaden nur insoweit, als dieser durch einen Sicherheitsmangel des zugelieferten Einzelteils verursacht wurde. Der Einwand des Mitverschuldens ist nach §§426, 254 BGB zu berücksichtigen. Dies muss in einer entsprechenden AGB-Klausel festge-halten werden. Die Beweislast in der Frage, ob eine bestimmte Verkehrssicherungs-pflicht erfüllt wurde, trifft den jeweiligen Träger dieser Pflicht. Insofern hat eine vertragliche Pflichtenverlagerung, etwa im Rahmen einer Just-in-time-Produktion, durchaus Folgen auch im Rahmen der deliktischen Haftung.
Besonders kostspielig auch im Verhältnis von Hersteller und Zulieferer können die Aufwendungen für Rückrufaktionen sein. Ist eine derartige Aktion auf den Fehler eines Zulieferteils zurückzuführen, so kann der Hersteller nach §§426, 830, 840 BGB beim Zulieferer Regress nehmen. Der Hersteller kann den Rückruf selbst vornehmen und vom Zulieferer verlangen, die entsprechenden Aufwendungen aus dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag nach §§683, 670 BGB zu ersetzen. Auch hier trifft im Regressprozess die Beweislast denjenigen, der die Verkehrssicherungspflicht im Innenverhältnis trägt.
Haftet ein Zulieferer dem Hersteller im Innenverhältnis (oder umgekehrt), weil er seine Verkehrssicherungspflicht verletzt hat, dann kann er diesem ein Mitverschulden nach §254 bzw. eine Mitverursachung nach §5 PHG entgegenhalten, wenn auch der Hersteller eine Pflicht im Verhältnis zum Zulieferer verletzt hat.
Zuliefervertrag mit Auslandsberührung
Im Rahmen der Produkthaftung kommt es zunehmend zu Schadensersatzansprüchen aus dem Ausland. Hierbei muss über die Anwendung der unterschiedlichen Rechtsordnungen und über den Ort entschieden werden, an dem der Prozess stattfinden soll. Es geht um Fragen des Internationalen Privatrechts und des Internationalen Zivilprozessrechts. Die Vertragsparteien können diese Fragen nur zu einem geringen Teil durch ihre Vertragsgestaltung beeinflussen. Die Vertragsparteien können vereinbaren, welcher Ort der Gerichtsstand und der Erfüllungsort sein soll. Hinzu kann eine Vereinbarung über die anzuwendende Privatrechtsordnung kommen. Dies gilt aber nur für Vertragsansprüche.
Bei den deliktischen Produkthaftungsansprüchen ist eine vorherige Wahl des Rechts und des Gerichtsortes grundsätzlich nicht möglich. Es gibt aber eine Vereinbarung zwischen den Staaten der Europäischen Union, das europäische Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVÜ). Nach Artikel 5 Nr. 3 EuGVÜ ist für Klagen aus unerlaubter Handlung (einschließlich Produkthaftungsklagen) das Gericht örtlich zuständig, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist.
Für den Bereich der Produkthaftung fragt es sich, ob der Ort, an dem das Produkt fehlerhaft konstruiert oder hergestellt wurde, oder der Ort gemeint ist, an dem der Schaden eingetreten ist (Handlungs- oder Erfolgsort). Nach einer Entscheidung des EuGH (Stg. 1976, S. 1735, Bier/Mines de Potasse d’Alsace) kann der Kläger wählen, ob er am Handlungs- oder am Erfolgsort klagt. Wird also wegen eines in Frankreich konstruierten und produzierten, fehlerhaften Zulieferteils ein in Deutschland konstruiertes und produziertes Auto fehlerhaft in den Verkehr gebracht und in Italien zerstört, so kann der Eigentümer des Autos nach seiner Wahl den Zulieferer in Frankreich, den Hersteller in Deutschland oder beide in Italien aus Produkthaftung auf Schadensersatz verklagen (vgl. auch die Darstellung bei Nagel, DB 1995, S. 2581–2590, 2589).
In einer Entscheidung aus dem Jahre 1995 hat der EuGH (EuZW 1995, 765 – Marinari) klargestellt, dass der Erfolgsort nicht alle Orte erfasst, an denen die schädlichen Folgen eines Umstandes deutlich werden können. Erfolgsort ist vielmehr nur der Ort, an dem der sogenannte Erstschaden (Rechtsgutverletzung) auftritt, nicht auch jeder Ort, an dem weitere Vermögensfolgeschäden auftreten. Damit ist aber noch nicht entschieden, welches materielle Recht angewendet wird. Es existiert eine Konvention über das auf die Produkthaftpflicht anwendbare materielle Recht. Dieser Konvention sind nur wenige Länder, darunter beispielsweise Frankreich, beigetreten, Deutschland jedoch nicht.
Das kodifizierte deutsche internationale Privatrecht enthält keine Kollisionsregeln zum anwendbaren Recht bei Delikten nach §§823 ff BGB und zur Produkthaftung. Gewohnheitsrechtlich entscheiden sich die Gerichte für das Recht des Tatorts. Der BGH steht auf dem Standpunkt, dass der Verletzte nach seiner Wahl als Tatort den Handlungsort oder den Erfolgsort wählen kann (BGH NJW 1981 S. 1806 = DB 1981 S. 1277; BGHZ 98 S. 263, 274 = DB 1986 S. 45). Erfolgsort ist hierbei der Ort, an dem die Rechtsgutverletzung, das heißt die Körperverletzung oder die Sachbeschädigung eintritt.
Handlungsort dürfte nach richtiger Ansicht der Ort sein, an dem das Produkt, das Zubehörteil oder das Endprodukt in den Verkehr gebracht wird. Nicht richtig erscheint die Auffassung, das Recht des Marktortes (an dem das Produkt vermarktet wurde) anzuwenden (so aber Wilde 1991, S. 180 ff.). In den Verkehr gebracht wird das Produkt, wo und wenn es das Werkstor verlässt, vermarktet wird es unter Umständen an vielen Orten. Nach dem jeweiligen internationalen Privatrecht des Ortes der Klageerhebung ist zu entscheiden, welches materielle Recht anzuwenden ist. Die Spielräume der Klageerhebung und die möglichen Komplikationen eines Prozesses sind erheblich.
Zusätzliche kollisionsrechtliche Probleme ergeben sich, wenn Vorfragen zu klären sind, z.B. die Frage, ob der Kläger Eigentümer der durch eine unerlaubte Handlung beschädigten Sache ist. Diese Frage ist beispielsweise nach dem internationalen Sachenrecht zu entscheiden, wobei der Grundsatz gilt, dass nach dem Recht des Ortes zu entscheiden ist, an welchem die jeweilige – zerstörte oder beschädigte – Sache gelegen ist. In dem angesprochenen Beispielsfall des französischen Zulieferers, des deutschen Herstellers und des in Italien entstandenen Schadens entscheidet sich, wenn in Italien ein anderer Wagen beschädigt wird, der einem Italiener gehört, die Eigentumsfrage zunächst nach dem italienischen Sachrecht, auf welches das internationale Sachrecht verweist.
Der Regressanspruch im Verhältnis von Hersteller und Zulieferer richtet sich nach dem jeweils anwendbaren Deliktsrecht. Steht jedoch hinter dem Schädiger ein Versicherer und wird dieser in Anspruch genommen, ist das sogenannte Drittleistungsstatut maßgeblich. Dieses Statut entscheidet insbesondere darüber, ob und in welcher Weise der Eintritt des Versicherers zu regeln ist. Im Normalfall ist das Recht maßgeblich, welches den Versicherungsvertrag beherrscht, nicht aber das Deliktstatut. Ansonsten ist beim Rückgriff daran zu erinnern, dass das deutsche Recht keine Kollisionsnorm über das auf den Rückgriff anzuwendende Recht enthält. Nach einer verbreiteten Ansicht ist das Recht maßgeblich, das die Haftung des Regressberechtigten gegenüber dem Geschädigten beherrscht (vgl. zu den Einzelheiten Wandt, BB 1994, S. 1436, 1442).
Zwischenergebnis
Festzuhalten ist, dass im modernen Produktionsverbund, der sich durch eine Internationalisierung und Intensivierung der Beziehung Zulieferer-Hersteller auszeichnet und mehr und mehr in einen Verbund auch im Bereich von Forschung und Entwicklung ausgeweitet wird, die faktischen Produkthaftungsrisiken zunehmen. Hinzu kommt, dass Gesetzgebung und Rechtsprechung neue Haftungstatbestände geschaffen haben, die nicht nur das Zuliefer- oder Herstellerunternehmen, sondern auch deren Leitungspersonen treffen.
Vertragliche Haftungsausschlussklauseln sind im Bereich der deliktischen Produkthaftung irrelevant, jedenfalls im Verhältnis zum geschädigten Endverbraucher. Die Ausweitung der Verkehrssicherungspflichten durch die Rechtsprechung führt dazu, dass oft beide, Zulieferer und Hersteller, gegenüber dem Verbraucher haften. Die Kombination von verschärfter Verschuldenshaftung und Gefährdungshaftung im Bereich der Produkthaftung führt dazu, dass die haftungsfreien Bereiche immer kleiner werden. Internationale Sachverhalte führen zu weiteren kollisionsrechtlichen Problemen, nicht nur im eigentlichen Produkthaftungsfall, sondern auch im Regressprozess.
Effizienz der existierenden Produkthaftung im Verhältnis von Herstellern und Zulieferern
Hier geht es um zwei praktische Probleme (vgl. Eger 1997, S. 73–87), die im Rahmen der Intensivierung und Internationalisierung des Produktionsverbundes sowie der Einführung von „Simultaneous Engineering“ bedeutsam werden, und um die Frage nach den Erkenntnissen, die aus den rechtsökonomischen Modellen gezogen werden können:
Qualitätsprobleme bei „unvorhersehbaren“ Risiken in der Produktion
Besondere Anreizprobleme ergeben sich in Fällen (z.B. in der Automobilindustrie), in denen ein Hersteller als Käufer von Zulieferteilen auftritt und dann das Gesamtprodukt (Auto) über Händler an den Endverbraucher verkaufen lässt. Eine Informationsasymmetrie zwischen Zulieferer und Hersteller kann in der Weise gegeben sein, dass der Zulieferer besser über die Fehlerwahrscheinlichkeit des Produkts informiert ist (d.h. über die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden eintritt), während der Hersteller besser über die Höhe eines möglicherweise eintretenden Schadens informiert ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn komplizierte Bauteile an Hersteller geliefert werden, die sehr unterschiedliche Anforderungen an die Qualität der Produkte stellen.
Würde man in derartigen Fällen den Zulieferer für alle Schäden haften lassen, so hätte das eine gesamtwirtschaftlich unerwünschte Konsequenz. Da die Zulieferer nicht in der Lage sind, zwischen guten und schlechten Risiken zu unterscheiden, und die durchschnittlich erwarteten Schadensersatzzahlungen über den Preis an alle Hersteller weitergegeben werden, subventionieren kurzfristig die guten Risiken (d.h. die Kunden mit geringem Schadenspotential) die schlechten Risiken (d.h. die Kunden mit hohem Schadenspotential).
Die Vorsorgemaßnahmen des Zulieferers sind für die Käufergruppe mit hohen Risiken zu gering, für die Käufergruppe mit niedrigen Risiken dagegen zu hoch. Die schlechten Risiken verdrängen zum Teil die guten Risiken (adverse Selektion), bestimmte gegenseitig vorteilhafte Verträge zwischen guten Risiken und Zulieferern kommen aufgrund der hohen Produktpreise, welche die zu hohen Kosten der Vorsorge (Qualitätskontrolle) und die zu hohen durchschnittlichen Risikozuschläge reflektieren, nicht zustande (vgl. Eger 1997, S. 79).
Das deutsche Recht trägt diesem Anreizproblem insofern Rechnung, als die Schadensersatzansprüche nach § 823 Absatz 1 gemindert werden, wenn der Hersteller den Zulieferer nicht auf das ungewöhnlich hohe Schadensrisiko aufmerksam gemacht hat und wenn der Zulieferer dieses Risiko weder kannte noch kennen musste (§ 254 Absatz 2 Satz 1 BGB). Darüber hinaus nehmen z.B. in der Automobilindustrie die Hersteller, welche ein höheres Schadenspotential einkalkulieren müssen, in ihrer Vertragspraxis durch die bereits erwähnten QS-Vereinbarungen und durch Qualitäts-Audits erheblichen Einfluss auf die Qualitätskontrolle ihrer Zulieferer. Dass die Hersteller dies tun, ist freilich in erster Linie eine Frage ihrer Verhandlungsmacht. Die Rechtsordnung ermöglicht lediglich eine derartige Vertragsgestaltung, sie erzwingt dies nicht. Führen Qualitätssicherungsvereinbarungen zu zusätzlichen Risiken für die Zulieferer, so ergeben sich „im Gegenzug“ zusätzliche Interessenwahrungs-, Sorgfalts- und Rücksichtspflichten der Hersteller (vgl. Nagel, DB 1991, S. 319–327).
„Unvermeidliche“ Entwicklungsfehler
Im Rahmen der umfangreichen Forschungs- und Entwicklungstätigkeit der Unternehmen werden vielfach neue Konstruktionsprinzipien und neue Materialien verwendet, die mit neuen Risiken verbunden sind. Die Risiken verstärken sich noch im Fall des „Simultaneous Engineering“ von Herstellern und Zulieferern, weil hier die eine Seite oft nicht weiß (und oft nicht wissen kann), wie sehr sie durch eine bestimmte Modifikation ihrer Entwicklung die Risiken der anderen Seite verstärkt. Derartige Risiken, die sogenannten Entwicklungsrisiken, unterliegen in vielen Ländern nicht der Produkthaftung, wenn sie nach dem Stand der Wissenschaft und Technik zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens des Produkts nicht erkannt werden können.
Die Produkthaftungsrichtlinie der EU lässt Spielraum für gesetzgeberische Lösungen, die eine Haftung für unvermeidliche Entwicklungsfehler vorsehen. Die Mitgliedstaaten sind hierzu aber nicht verpflichtet. Deutschland hat die Haftung für sogenannte unvermeidliche Entwicklungsfehler ausgeschlossen (§1 Absatz 2 Nr. 5 PHG). Voraussetzung ist, dass der Fehler nach dem Stand der Wissenschaft und Technik nicht erkannt werden konnte, als das Produkt vom Hersteller in den Verkehr gebracht wurde.
Gibt diese Entscheidung des deutschen Gesetzgebers die richtigen Verhaltensanreize? Will man die Frage beantworten, sind zwei Aspekte zu berücksichtigen: Zum einen wird durch den Ausschluss der Haftung für sogenannte unvermeidliche Entwicklungsfehler der Anreiz des Herstellers verringert, durch eigene Forschungs- und Entwicklungstätigkeit den Stand der Wissenschaft und Technik zu verbessern und neue Risiken frühzeitig zu entdecken. Zum anderen könnte eine Haftung für Entwicklungsrisiken aber dazu führen, dass risikoaverse Hersteller keinen Anreiz mehr haben, neue Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, die zwar in vieler Hinsicht besser und sicherer als die alten Produkte sind, bei denen aber nicht ganz ausgeschlossen werden kann, dass im Laufe der Zeit bisher unbekannte Schäden aus Produktfehlern auftreten.
Die deutsche Gesetzgebung und Rechtsprechung zur Produkthaftung lösen die Abwägung zwischen Sicherheit und Innovationsförderung, indem zwar einerseits § 1 PHG die Gefährdungshaftung für Entwicklungsrisiken ausschließt, die Rechtsprechung aber andererseits weiterhin eine Produktbeobachtungspflicht des Herstellers im Rahmen von § 823 Absatz 1 BGB konstatiert, die Haftung für eine Pflichtverletzung durch eine Beweislastumkehr noch verschärft und damit für ihn einen Anreiz schafft, neue Risiken schnell zu erkennen. (vgl. Schäfer/Ott 1995, S. 294; Eger 1997, S. 79).
Perspektiven für Gesetzgebung und Rechtsprechung
Versucht man, die Perspektiven für Gesetzgebung und Rechtsprechung einzuschätzen, so sind Argumente der Art, dass Europa immer mehr den abschüssigen Weg der USA in der Produkthaftung nachahme, wenig sinnvoll. Zum einen ist in Deutschland nicht zu beobachten, dass sich die in Produkthaftungsprozessen zuerkannten Schadensersatzsummen in ähnlich schwindelerregenden Höhen bewegen, wie dies aus den USA berichtet wird. Es ist auch richtig, dass in den USA aufgrund dieser Entwicklung eine Reihe von Produkten wegen der drohenden Produkthaftungsrisiken aus dem Markt genommen werden musste, während in Deutschland spektakuläre Fälle dieser Art nicht bekannt geworden sind.
Der Grund für die Entwicklung in den USA liegt allerdings nicht pauschal in der Einführung einer Gefährdungshaftung, sondern vor allem im Zivilprozess der US-amerikanischen Bundesstaaten. Das Jurysystem (Geschworenengerichte auch im Zivilprozess) führt dazu, dass die Jurymitglieder, welche den Schadensersatz festlegen, sich oft dazu verleiten lassen, von dem reichen Herstellerunternehmen nach der sogenannten „deep pocket doctrine“ durch einen Griff in dessen Taschen Geldsummen abzweigen, um dann dem Geschädigten zu helfen (vgl. Nagel DB 1995, S. 2581–2590, 2589). Die Jurymitglieder sind nur kurzfristig in ihrem Amt tätig, brauchen ihre Entscheidungen nicht zu begründen und keine persönlichen oder beruflichen Nachteile bei Fehlentscheidungen hinzunehmen.
Deshalb werden hohe Schadensersatzbeträge für Gesundheitsschäden und für Schmerzensgeld zuerkannt. Der zumutbare Informationsstand des Konsumenten wird meist zu niedrig angesetzt. Wenn beispielsweise in einem von Schäfer und Ott (vgl. Schäfer/Ott 1995, S.289f.) zitierten Fall der Hersteller eines alkoholhaltigen Parfüms zum Schadensersatz verurteilt wird, weil der Benutzer es auf eine brennende Kerze gegossen und dadurch eine Explosion verursacht hat, dann wird vom Gericht der Gedanke vernachlässigt, dass Schadensersatz nur bei einem im weitesten Sinne bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts gewährt werden sollte.
Die Frage nach dem bestimmungsmäßigen Gebrauch hatte der BGH im Fall „sniffing“ (BGH NJW 1981, 2514) zu entscheiden. Hier hatte der Sohn des Käufers eines Reinigungsmittels dessen Dämpfe eingeatmet, um sich zu berauschen. Er war daran gestorben. Der BGH lehnte Ersatzansprüche der Eltern zu Recht ab. Eine Instruktionspflicht des Herstellers bestehe nur insoweit, als es um den – im weitesten Sinne – bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts gehe. Hier sei das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch unschädlich.
Im Regelfall sollte der Hersteller nicht haften, wenn ein Fehlgebrauch in der Weise vorliegt, dass der Verbraucher die klar erkennbaren Informationen des Herstellers nicht beachtet. Andernfalls würden die Community Standards durch die Rechtsprechung abgesenkt. Die Entwicklung der „Community Standards“ ist nur eines der Probleme, das durch die Entwicklung der Produkthaftung angestoßen wird. Größere Probleme liegen woanders: Durch eine überkomplexe Struktur des Rechts, sowohl des materiellen als auch des Prozessrechts, wird ein Spezialgebiet für die Anwälte und Gerichte geschaffen, dessen Entwicklung nicht nur dem Laien, sondern auch dem gewöhnlichen Juristen nicht mehr verständlich ist. Ferner zeichnet sich eine Ausweitung der Haftung in Bereiche hinein ab, die ursprünglich nicht von der Produkthaftung erfasst waren.
Um zur Problematik der Zulieferbeziehungen zurückzukommen: Es ist zu erwarten, dass im Falle des „Simultaneous Engineering“ der Kreis der unvermeidlichen Entwicklungsfehler von der Rechtsprechung sehr eng gezogen wird, dass also Zulieferer und Hersteller sich jeweils um die Funktionsfähigkeit des späteren Gesamtprodukts zu kümmern haben, d.h. sich auch den Kopf der anderen Seite des Entwicklungsvorhabens zerbrechen müssen. Im Zusammenhang mit der Produktbeobachtungspflicht könnte sich ein Rechtszustand einspielen, der sich kaum noch von der vollen Gefährdungshaftung, auch für unvermeidliche Entwicklungsfehler, unterscheidet.
Noch völlig ungeklärt ist, wie das Haftungsrecht in Zukunft auf Risiken reagieren wird, die sich erst in der Zeitdimension verwirklichen. In der Produkthaftung gibt es ebenso wie in der Umwelthaftung das Problem der Distanz- und der Summationsschäden, nur dass der Gesetzgeber im Produkthaftungsgesetz hierzu schweigt. Es ist zu erwarten, dass die Rechtsprechung zu den Produktbeobachtungspflichten auch einen Anreiz geben wird, die Möglichkeit derartiger Schäden zu untersuchen.
Hinzu kommen Detailfragen: Wann ist eine versuchstechnische Erprobung hinreichend? Wie weit reichen die Erfordernisse von zusätzlichen betrieblichen Kontrolleinrichtungen? Wie weit muss ein technisch mögliches Sicherheitsniveau angehoben werden, wenn die Anhebung an die Grenzen der wirtschaftlichen Vertretbarkeit stößt? Ist eine Haftungsbegrenzung durch nicht-staatliche Regelwerke wie z.B. Branchenstandards, technische Regeln und Qualitätssicherungssysteme möglich und wenn ja, wo liegen hier die Grenzen?
Bei all diesen Fragen erscheinen Effizienzüberlegungen zur Entscheidungsfindung hilfreich. Effizienzüberlegungen können Gerechtigkeitsüberlegungen zwar nicht ersetzen. Das Kaldor-Hicks-Kriterium ist zwar als Gerechtigkeitskriterium nicht konsensfähig, da es zu völlig unvertretbaren Verteilungsergebnissen führen kann. Effizienzüberlegungen sind aber allgemein sinnvoll, um die Kosten der Gerechtigkeit zu erfassen, d.h. um festzustellen, welche Kosten bei einer Maßnahme, die der Gesetzgeber für gerecht hält, in Kauf genommen werden müssen, während eine etwas weniger gerechte Maßnahme möglicherweise erheblich niedrigere Kosten verursachen und Spielraum für andere Staatsaufgaben lassen würde.
Literaturverzeichnis:
–Bauer, C. O./Westphalen, F. Graf von (Hrsg.) (1996), Just-in-Time-Lieferungen und Qualitätssicherungsvereinbarungen, Berlin.
–Eger, T. (1997), Ökonomische Aspekte einiger neuerer Vertragsrisiken, in: Hart, D. (Hrsg.), Der Stellenwert des Privatrechts im Risikostaat, Baden-Baden, S. 73-87.
–Heine, G. (1996), Strafrecht und Qualitätssicherung, in: Bauer, C. O./Westphalen, F. Graf von (Hrsg.), Das Recht zur Qualität, Die Rechtsgrundlagen der Qualitätsorganisation, Berlin.
–Mertens, H. J. (1997), Kommentierung zu § 823 BGB, in: Kommentar zum BGB, Band 5, 3. Auflage, München.
–Merz, K. (1992), Qualitätssicherungsvereinbarungen, München.
–Nagel, B./Eger. T. (1997), Wirtschaftsrecht II, 3. Auflage, München.
–Reinicke, D./Tiedtke, K. (1997), Kaufrecht, 6. Auflage, Neuwied.
–Schäfer, H. B./Ott, C. (1995), Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 2. Auflage, Berlin.
–Wilde, H. (1991), § 100: Internationales Privatrecht, in: Westphalen, F. Graf von (Hrsg.), Produkthaftungshandbuch, Band 2. Das deutsche Produkthaftungsgesetz, internationales Privat- und Prozessrecht, Länderberichte zur Produkthaftung, München, S. 179–189.
–Hahn/Kaufmann: Handbuch Industrielles Beschaffungsmarketing, Wiesbaden 1999, Verlag Dr. Th. Gabler GmbH
Teilen: